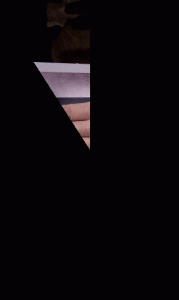Im nächsten Teil meiner Reihe von Gesprächen mit der Handvoll Menschen, die das „Licht …“ bereits gelesen haben, ist diese Woche meine Kollegin Diana Menschig an der Reihe, deren Roman Hüter der Worte gerade bei Knaur erschienen ist.
 Diana Menschig, geboren 1973, absolvierte nach einem Studium der Psychologie mehrere Stationen in Marktforschung und Personalmanagement, bevor sie einen Spieleladen eröffnete. Heute arbeitet sie als selbständige Dozentin und Autorin. Wenn sie nicht gerade in fantastischen Parallelwelten unterwegs ist, teilt sie sich mit ihrem Mann, zwei Hunden, einer Katze und vielen Rennrädern ein Haus am Niederrhein.
Diana Menschig, geboren 1973, absolvierte nach einem Studium der Psychologie mehrere Stationen in Marktforschung und Personalmanagement, bevor sie einen Spieleladen eröffnete. Heute arbeitet sie als selbständige Dozentin und Autorin. Wenn sie nicht gerade in fantastischen Parallelwelten unterwegs ist, teilt sie sich mit ihrem Mann, zwei Hunden, einer Katze und vielen Rennrädern ein Haus am Niederrhein.
Diana: Lieber Oliver, sehr herzlichen Dank für deine Einladung zum nächsten Gastgespräch.
Oliver: Ich habe zu danken.
D: Ich war ja nun eine der Leserinnen, die das „Licht …“ schon testlesen durften. Und auch wenn ich natürlich einige kritische Anmerkungen hatte, finde ich die Geschichte großartig und freue mich auf das Buch!
Daher beginne ich auch direkt mit den Fragen, die mir dazu unter den Nägeln brennen: Zu meinen absoluten Lieblingsfiguren gehören die „lonesome wolves“ Lesardre sowie Cassiopeia: Vom Schicksal getriebene und gebrochene Figuren, die sich mit ihrer Situation nicht abfinden wollen und rebellieren, dabei einsam, melancholisch und auch etwas düster wirken. Es ist — soweit ich das sehe — das erste Mal, dass du diesen Figuren-Archetypus in einem deiner Bücher verwendest. Was magst du an ihnen besonders, was nicht?
O: Solche eher düstere Figuren hätten in meine bisherigen Bücher wirklich schlecht gepasst (am ehesten geht vielleicht noch Cosmo van Bergen in diese Richtung, aber der war kein Held, und keine Hauptfigur). Ich hatte auch gewisse Berührungsängste, ob sie nicht zu abgegriffen wirken, denn beide sind alte Rollenspielfiguren mit deutlichen Anklängen an Elric von Melniboné oder auch Conan. Bei so etwas muss man vorsichtig sein. Ich war selbst überrascht, wie gut es geklappt hat; Cassiopeias Geschichte ist eigentlich ein Buch im Buch geworden und enthält viele meiner Lieblingspassagen.
Was mich an solchen Figuren wohl fasziniert — und vielleicht nicht nur mich — ist ihre sture Konsequenz, ohne jede Rücksicht auf sich selbst oder andere. Cassiopeia trifft eine Entscheidung nach der anderen, die für sie zwar vollkommen logisch ist, bei jedem vernünftigen Menschen aber die Alarmglocken gellen lassen müsste. So etwas bewundern wir, weil wir so nie handeln würden. Es gehört schon ein gewisser Größenwahn dazu, sich über all die Zwänge zu erheben, die unseren Alltag bestimmen. Gleichzeitig sind beide Geschichten, Cassiopeias wie Lesardres, auch Geschichten über Schuld, und das ist ein Thema, zu dem ich sehr häufig zurückkehre.
D: Siehst du da einen Unterschied zwischen den weiblichen und den männlichen Figuren? Ich als Leserin finde es für männliche häufig passender, wobei Cassiopeia extrem gut gelungen ist.
O: Danke. In der Regel mache ich eigentlich keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern; zumindest lasse ich meine Figuren nie bewusst Entscheidungen treffen, weil etwas jetzt vermeintlich „typisch Mann“ oder „typisch Frau“ ist. Ich bin immer überrascht, wenn Leser es dann doch so empfinden, und glaube, dass Projektion hier eine große Rolle spielt.
D: Meinst du mit Projektion, dass die Leser automatisch den Figuren Attribute oder Taten des entsprechenden Geschlechts zuordnen? Also bei einem Mann „männliche Handlungen“ als „richtiger“ empfunden werden?
O: Eigentlich sogar, dass man als Leser einer Figur, ob „Mann“ oder „Frau“, automatisch die erwarteten Attribute andichtet, ob der Autor sie nun nennt oder nicht.
D: Das könnte sein. Wir alle werden sicherlich im Alltag immer noch mit Geschlechterstereotypen konfrontiert. Ich habe aber Leser viel gnädiger erlebt, solange das Gesamtbild stimmt. Im „Hüter der Worte“ ist zum Beispiel der Protagonist Tom ein unglaublich romantischer Typ, während seine Freundin Mellie eine knallharte, rationale Analytikerin ist. Den Stereotypen entsprechend müsste es eher umgekehrt sein, aber darüber hat sich, bei aller Kritik, noch niemand beschwert.
O: Was macht Tom vom Gesamtbild dann eher „männlich“? Erzähl doch mal ein bisschen vom „Hüter der Worte“ — das Buch kommt ja gerade richtig gut an. Ich weiß, dass Tom den Weg von unserer Welt in eine andere entdeckt …
D: Oh je, „männlich“ ist kein Attribut, das mir bei Tom in den Sinn kommen würde, maximal „junger Mann“. Dazu empfinde ich ihn noch als viel zu unreif … Aber das müssen die Leser(innen) entscheiden.
 Tom Schäfer ist in seinem „wahren“ Leben Student und Fantasy-Autor und lebt in Münster. Er ist ein typischer Geek, Rollenspieler und extrem internetaffin. Daher fällt es ihm leicht, die Existenz dieser anderen Welt zu akzeptieren, denn virtuelle und/oder Rollenspiel-Welten sind für ihn auch nichts anderes als alternative Realitäten.
Tom Schäfer ist in seinem „wahren“ Leben Student und Fantasy-Autor und lebt in Münster. Er ist ein typischer Geek, Rollenspieler und extrem internetaffin. Daher fällt es ihm leicht, die Existenz dieser anderen Welt zu akzeptieren, denn virtuelle und/oder Rollenspiel-Welten sind für ihn auch nichts anderes als alternative Realitäten.
Bevor du fragst: Den Hintergrund habe ich mit dieser Figur gemeinsam, dennoch identifiziere ich mich wenig mit Tom, sogar weniger als mit anderen Figuren im Buch. Das Schreiben und sein Erfolg „passieren“ ihm eher zufällig und seine Arbeitsweise als Autor ist eine Katastrophe.
Ich nehme das Schreiben dagegen sehr ernst und du weißt selbst, dass es so manches Mal harte Arbeit ist. Und den Erfolg hätte ich gern. Aber das kann ja noch kommen …
O: Schreibst du als Frau lieber über Männer?
D: Gegenfrage, ist das wirklich so ungewöhnlich? Diese Frage habe ich nämlich bereits intensiv mit meiner Lektorin und auch mit Kollegen diskutiert. Dabei fallen mir spontan Robin Hobb, Joanne K. Rowling oder Rebecca Gablé ein, deren Protagonisten alle männlich sind.
Tatsächlich ist „Hüter der Worte“ sehr männerlastig. Meine Lektorin hat darin eine Gefahr gesehen, dass Leserinnen eine mögliche Identifikationsfigur fehlt. Daher hat Toms Freundin Mellie im Verlauf der Überarbeitung einen wesentlich höheren Anteil bekommen. Eine weitere Gegenmaßnahme war mein (weiblicher) Real-Name auf dem Cover. Nach meinem Wunsch wäre das Buch unter dem Pseudonym „Tom Schäfer“ erschienen, was der Buch-in-Buch-Thematik eine weitere Dimension verliehen hätte.
Bisher gefällt es Leserinnen besser als Lesern. Es ist also ein „Frauen-Buch“, trotz (oder wegen?) der vielen Kerle.
O: Tom ist in Deinem Blog ja auch ein Alter Ego von Dir geworden. Diese Freude am Identitätenspiel im Netz scheinen wir zu teilen … Aber ich glaube, wir schweifen ab.
D: Ja, stimmt beides. Also zurück zur Frage: Schreibe ich lieber über Männer? Nicht bewusst. Aber es scheint mir besser zu gelingen. An den weiblichen Perspektiven wird viel mehr herumkritisiert. Warum, ist mir wirklich ein Rätsel.
O: Waren diese Kritiker denn überwiegend Frauen oder Männer?
D: Beide. Auch nach längerem Nachdenken fällt mir kein Unterschied auf. Es gibt nur eine Handvoll Leute, mit denen ich über so etwas spreche, Wie die Kritik ausfällt, ergibt sich eher aus dem Kontext und wie diese Personen insgesamt zu mir stehen, weniger aus dem Geschlecht.
Schreibst du denn generell über ein Geschlecht lieber? Fällt dir eins leichter?
O: Eigentlich nicht. Je nach sexueller Orientierung hat man zu den Figuren des entsprechenden Geschlechts aber vielleicht eine romantischere Beziehung. Deshalb hat es mir auch sehr geholfen, dass du meinen „männlichen“ Blick auf weibliche Figuren (im wahrsten Sinne) etwas korrigiert hast …
D: Damit spielst du auf eine Szene an, in der Cassiopeia das Alter einer nackten Frau abschätzt, indem sie ihre …
O: *hust*
D: Ja, eine Frau würde vermutlich eher auf Krähenfüße um die Augen oder Orangenhaut an den Oberschenkeln achten … Im Ernst: Mir ist es mit meinen männlichen Testlesern genauso ergangen. In einer Szene hat Laryon, Toms Romanfigur und die zweite (ebenfalls männliche) Hauptperson des Buches, „Unterleibsschmerzen“. Ich hatte diesen Begriff gewählt, weil ich die unglaubliche Agonie in Worte fassen wollte, die es Laryon unmöglich macht, es genauer zu lokalisieren. Ich wurde aber dezent darauf hingewiesen, dass Männer einfach „Bauchschmerzen“ sagen würden, selbst bei einer Blasenentzündung. Ein zweiter Leser bestätigte das energisch. Seitdem fällt mir besonders auf, wenn ein Autor seinen weiblichen Figuren männliche Betrachtungen zuschiebt und umgekehrt.
O: Da muss ich zustimmen. Männer haben keinen Unterleib. Die meisten Männer wissen nicht einmal, dass etwas wie Blasenentzündung existiert. Bauchschmerzen kennen sie dagegen vom Essen.
Nächste Woche: Über Kritik und den sachgerechten Umgang damit.
 Die Freude, das Buch endlich so zu sehen, wie es mal sein wird, mischt sich mit dem blanken Entsetzen darüber, auf jeder zweiten Seite noch Änderungen anbringen und anderen Leuten damit wieder Arbeit machen zu müssen, während man panisch zwischen Laptop und Papierstapeln rotiert. Aber so ist es immer — egal, wie lange man an einem Buch arbeitet.
Die Freude, das Buch endlich so zu sehen, wie es mal sein wird, mischt sich mit dem blanken Entsetzen darüber, auf jeder zweiten Seite noch Änderungen anbringen und anderen Leuten damit wieder Arbeit machen zu müssen, während man panisch zwischen Laptop und Papierstapeln rotiert. Aber so ist es immer — egal, wie lange man an einem Buch arbeitet.